
Wie geht es mit der Menschheit weiter? Was für Konsequenzen hat die Digitalisierung? Das Goethe-Institut lud nach Weimar zu einem internationalen Gedankenaustausch.


Verbund arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen
Kooperation statt Konkurrenz — Wege in Arbeit durch Fortbildung, Weiterbildung und Beschäftigung

Wie geht es mit der Menschheit weiter? Was für Konsequenzen hat die Digitalisierung? Das Goethe-Institut lud nach Weimar zu einem internationalen Gedankenaustausch.

In vielen Bundesländern gibt es ein Anrecht auf den Bildungsurlaub: Fünf Tage im Jahr können Arbeitnehmer nutzen, um sich beruflich und persönlich weiterzubilden. Die Zeit bezahlt der Arbeitgeber, die Weiterbildungskosten der Arbeitnehmer – die können dann von der Steuer abgesetzt werden.

Der deutschen Wirtschaft droht angesichts der wachsenden globalen Risiken nach Expertenprognosen eine weitere Verlangsamung des Konjunkturtempos.
Dass dies nun auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen wird, ist für die Ökonomen unzweifelhaft.

Im Jahr 2018 gelang erneut mehr Hartz-IV-Beziehern die Integration in den Arbeitsmarkt. Dies geht aus der Integrationsquote der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor. Doch nicht einmal die Hälfte der Arbeitsaufnahmen führt dazu, dass der Leistungsbezug beendet wird.

Der Landesausschuss für Weiterbildung (LAWB) beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren regelmäßig mit dem Thema „Diversität“. Die Ergebnisse flossen in konkrete Ziele und Empfehlungen für die Einrichtungen der Weiterbildung im Land Bremen ein, die nun veröffentlicht wurden.

Die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten gelingt derzeit zwar besser als anfangs erwartet, bleibt aber schwierig. Aufgrund der Fluchtsituation haben die Menschen individuelle Hürden im Gepäck, zum Beispiel mangelnde Sprachkenntnisse oder fehlendes Wissen über den deutschen Arbeitsmarkt. In Deutschland angekommen, finden sie dann zusätzliche, institutionelle Hürden vor, die Politik und Verwaltung aufbauen.

Das von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller vorgeschlagene „Solidarische Grundeinkommen“ könnte zwar die Teilhabechancen der Betroffenen tatsächlich verbessern, der Vorschlag ist aber mit gewissen Risiken und Nebenwirkungen verbunden.
So besteht unter anderem die Gefahr, dass reguläre Beschäftigung verdrängt wird. Eine Verwendung der grundsätzlich knappen Haushaltsmittel für Beratung und Vermittlung sowie für Förderinstrumente, die möglichst passgenau die Bedarfe und Potenziale der Erwerbslosen berücksichtigen, wäre eine bessere Alternative

SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil wollte Jobs für bis zu 150.000 Langzeitarbeitslose schaffen. Bisher hat nur ein Bruchteil davon eine Beschäftigung gefunden

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V. (bag arbeit) bietet am 26. September 2019 in Hannover das Seminar Qualitätsgesicherte Wiederverwendung an.
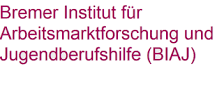
Im Mai 2019, vierzehn Monate nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD am 12. März 2018, wurden von allen 406 Jobcentern zusammen insgesamt 14.267 Beschäftigungsverhältnisse gemäß § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) gefördert.
Das heißt: Mitte Mai 2019 wurden mit dem zum 1. Januar 2019 neu in das SGB II eingefügten § 16i („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) noch immer weniger Beschäftigungsverhältnisse gefördert als mit dem 31. Dezember 2018 beendeten Bundesprogramm („Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“) und bisher nur knapp ein Zehntel (9,5 Prozent) der genannten „150.000“ im Koalitionsvertrag.
Die aktuellen Daten, detailliert für die einzelnen Länder, zusammengestellt vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ).
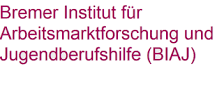
In den Ländern stellt sich die Entwicklung dieser Ausgaben des Bundes (Bundeshaushalt, nicht „Arbeitslosenversicherung“) sehr unterschiedlich dar.
Die aktuellen Daten, detailliert für die einzelnen Länder, zusammengestellt vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ).

Die zunehmenden Digitalisierungsprozesse in der Gesellschaft können Geschlechtergerechtigkeit und Integration befördern, bergen aber auch viel sozialen Sprengstoff. Darauf weisen Wissenschaftler und IT-Experten in schriftlichen Stellungnahmen an den Düsseldorfer Landtag hin.

Den „Qualifizierungsbonus“ von 150 Euro pro Monat kann zusätzlich zu den lebensunterhaltssichernden Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) erhalten, wer an einer Umschulung zum nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses teilnimmt.

Bund, Länder, Sozialpartner und die Bundesagentur für Arbeit (BA) haben den Grundstein für eine neue Weiterbildungskultur gelegt.
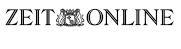
Viele in der SPD wollen ihn, die CDU ist gegen einen viel höheren Mindestlohn. Auch Detlef Scheele, Sozialdemokrat und Chef der Bundesagentur für Arbeit, ist skeptisch.
Im Interview spricht er über die Herausforderungen am Arbeitsmarkt, die Grundsicherung und warum er eine schnelle Anhebung des Mindestlohns für problematisch für die Wirtschaft hält.

Junge Arbeitnehmer sind immer unzufriedener mit ihrem Job. Mit viel Leidenschaft, aber für wenig Geld zu arbeiten, reicht den meisten nicht mehr aus, zeigt eine aktuelle Studie.

Besonders angesichts des rasanten Strukturwandels, der Umwälzungen durch die Digitalisierung der Arbeitswelt und dem drohenden Fachkräftemangel wird Weiterbildung immer mehr zu einer Zukunftsfrage. Berufsbilder und Qualifikationsprofile werden sich in den kommenden Jahren massiv wandeln.
„Politik und Unternehmen dürfen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angesichts des Transformationsprozesses nicht im Regen stehen lassen“, sagt Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende.
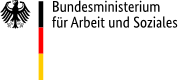
Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie legen Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam den Grundstein für eine neue Weiterbildungskultur. Damit gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine nationale Weiterbildungsstrategie.

Jobs entstehen und verschwinden wieder, Berufsbilder ändern sich oder sterben. Deshalb soll nun lebenslang gelernt werden. Aber viele Maßnahmen bringen die Karriere nur wenig voran.

Die CDU tut so, als stünde der Sozialismus vor der Tür. Was würde Grün-Rot-Rot ändern? Einiges. Doch radikal wäre so ein Linksbündnis nicht.